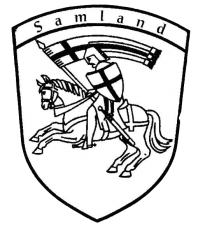Kallen – Compehnen und Umgebung
erlebt Juni 1945 – Nov. 1947
Aus dem Heimatbrief 108. Folge Winter 1990
Die Berichte von Herrn Karl Nagel über die letzten Tage in und um Kallen haben mich „Käthe Swiderski, geb. Goerke, in Kallen geboren und aufgewachsen“ angeregt, über die Jahre 1945-1947 in Kallen und Umgebung zu schreiben.
Bin bis Danzig geflüchtet, dort mußte ich meine 3 Kinder, die mir starben, beerdigen. Meine Mutter, die mit den Compehner Gutsleuten bis Danzig gekommen war, habe ich da gefunden. Da hieß es:“Im Juni 1945 haben alle Deutschen Danzig zu verlassen, jeder geht dahin, wo er hergekommen ist.“ Für uns schien das Leben vorbei zu sein, die Kinder tot und würde mein Mann aus dem Krieg wiederkommen? So wollten wir zu Hause sterben und machten uns auf den Weg.
Wir trafen unterwegs Frauen und Kinder, die dasselbe Ziel hatten – nach Hause. In kleinen Gruppen ging es langsam durch die Weichsel-Niederung über die Weichsel, Marienburg bis Elbing. Die alten Leute waren erschöpft, wir gingen zum Elbinger Bahnhof, wo wir hofften, von den Russen bis Königsberg mitgenommen zu werden. Man versprach es uns auch, doch mußten wir zunächst das Bahnhofsgebäude reinigen und Waggons von schweren Eisenteilen entladen. Danach durften wir auf offenen Güterwagen, die mit Schienen beladen waren, mitfahren. Es beschlich uns die Furcht, ob man uns in Königsberg aussteigen lassen oder ob man uns nach Rußland weiter transportieren würde. Doch man ließ uns auf dem Königsberger Bahnhof aussteigen. Russen, die uns auf dem Bahnsteig beobachtet hatten, führten uns in eine große Halle, wo wir ein notdürftiges Nachtquartier bekamen. Am nächsten Tag mußten wir wieder Räume sauber machen. Danach ließ man uns ziehen, aber ein Hindernis gab es, wir mußten uns einer langen Schlange von Wartenden anschließen und sollten für Königsberg registriert werden. Dies wollten wir keinesfalls, denn wir wollten ja ins Samland. Meine Mutter sowie noch andere Personen und ich traten aus der Reihe und wollten weiter. Schnell sperrte ein Soldat mich und eine andere junge Frau in einen Keller. Unsere Mütter standen weinend vor dem Kellerfenster. Da erbarmte sich ein Offizier und ließ uns heraus.
Nun kamen wir ungehindert bis Juditten. Wir trafen Frauen aus dem Samland, die in Königsberg arbeiteten und uns freundlicherweise ein Nachtquartier und eine karge Mahlzeit anboten. Unsere Dankbarkeit war groß. Richtung Vierbrüderkrug begegnete uns ein Panjewagen mit einem älteren Russen darauf. Ich faßte Mut ihn zu bitten, uns doch mitzunehmen. Er wollte nach Pillau, wir wollten in Caspershöfen absteigen. Wieder die bange Frage: Wird er uns herunterlassen? Doch er hielt auf unseren Wunsch an, schenkte uns sogar etwas Brot und Zucker.
Unheimlich still war es im Fichtenwald. Nur einen Soldaten trafen wir, der aber keine Notiz von uns nahm. Am Kaller Teich, dem sogenannten „Heller“ stand ein Schlagbaum mit einem Posten, der Dokumente verlangte. Er war mit unseren alten Kleiderkarten als Ausweise zufrieden und ließ uns ziehen. Wir sahen das Deputantenhaus, das Gutshaus und die Insthäuser noch stehen. Unser Ziel war Compehnen, denn meine Mutter hatte dort für die alte Frau von der Goltz den Haushalt im kleinen Inspektorhaus geführt. Die Schule, die ich acht Jahre lang besucht hatte, war auch unversehrt, sie war zu einem Lebensmittel-Lager umfunktioniert worden. Neugierig blickte ein Soldat auf uns, ließ uns aber weiter ziehen
Der Weg war sehr zerfahren und schwer passierbar. Würden wir Deutsche in Compehnen antreffen und was würde uns erwarten? Diese Frage brannten in uns. Die große Scheune war zerbombt, das kleine Haus daneben ausgebrannt, der Kuhstall auch ein Bombentrichter. Das Gutshaus stand und auch einige Insthäuser.
In unser großes Herzeleid nach allem Geschehen und dem Anblick der Zerstörungen, mischte sich doch eine tiefe Dankbarkeit und etwas Geborgenheit, einige Compehner Gutsleute, die schon vor uns Danzig verlassen hatten, vorzufinden. Die Familie des Schmiedemeisters Guttzeit nahm uns zunächst auf. Im Gutshaus war eine Russische Einheit eingezogen. Doch wie sah es darin aus? Ich hatte dort als Kinderpflegerin die 4 Kinder der Familie von der Goltz betreut. Kein Möbelstück existierte, die Dielen waren herausgerissen, auf Stellagen schliefen die Offiziere. Nun holte man mich zum Aufwischen der Zementfußböden und das dreimal täglich, denn man wollte uns ja Kultur beibringen. Wenigstens bekam ich etwas zu Essen aus der Feldküche und konnte meiner Mutter davon etwas mitbringen.
Es gab dann etwas Getreide zu ernten, das die zuletzt in Compehnen verbliebenen Leute im April 1945 noch eingsät hatten. Noch nie hatte ich Garben gebunden und jedes Bund ging wieder auf, was mich nicht störte. Dann begann der Hunger-Typhus, den meine Mutter nach dreimonatigem Krankenlager überstand. Ich kam schneller wieder auf die schwachen Beine. Inzwischen war die Einheit abgezogen und wir wurden nachts oft belästigt und beraubt, sogar angerührter Brotteig wurde auf dem Fußboden geschüttet, aus Schikane.
Weil in Kallen eine Einheit stationiert war, zogen wir Schutz und Wohnung suchend dorthin. Auf Bruch mußten wir Kartoffeln graben. Bis zum Nachmittag mußten wir auf dünne Kohlsuppe warten. Der Durst war groß und ich trank aus einem stehenden Bombentrichter, wie hätte das mein Tod sein können! In Kallen konnten wir die noch vorhandenen Saubohnen vom Feld holen. So tat sich immer wieder ein Türlein auf und wie man sieht, es stirbt sich nicht so schnell. Eine Feldarbeit fanden wir auch in Norgau.
Meine Mutter und ich lebten mit Kämmerer Weiss und Förster Marter in einer Wohngemeinschaft. So konnten wir uns ergänzen, denn meine Mutter kochte für uns drei, die wir ja zur Arbeit mußten. Für die wenige Kleidung, die wir besaßen, wurde zum Waschen aus Asche Lauge gekocht. Weiße Drillichhosen unserer Wehrmacht wurden mit Eichenrinde gefärbt. Herr Marter hatte weitblickend Sämerein versteckt und da wurden Kohl, Rüben, Karotten und Tomaten ausgesät. Dadurch ging als Mundraub soviel wie möglich in unsere Hosentaschen, über die wir große Schürzen von Zeltplanen trugen, damit es nicht auffiel.
Das in Compehen geerntete Getreide war beim Friedhof als Berg aufgesetzt worden. Es mußte ja nun ausgedroschen werden. Not macht bekanntlich erfinderisch. Es wurden noch vorhandene Scheunentüren zum Getreideberg transportiert, darauf die Garben gelegt und mit teilweise Flegeln oder Knüppeln draufgeschlagen. Posten bewachten uns. In Säcken mußten wir die Körner auf dem Rücken nach Kallen tragen. Mein Sack war wohl nicht schwer genug und ich wurde zur Strafe im ehemaligen Hühnerhaus, das später als Wohnung für Familie Polleit umgebaut worden war, gesperrt.
Im Winter 1946 bekam ich mit einem Mädchen die Arbeit zugeteilt, aus Futerrüben Sirup zu kochen. Schwer war es für uns, die Rüben vom Feld zu holen, dann bei großer Kälte ohne rechtes Schuhzeug mit stumpfen Sägen nasses Holz zu sägen. In einer Küche eines Insthauses wurden die Rüben gekocht. Wenn wir morgens zur Arbeit kamen, war alles eingefroren. Eine Presse wurde auch aufgetrieben. Sehr begehrt waren die ausgepressten Schnitzel. Dies hatte sich bis Medenau herumgesprochen und halbverhungerte Kinder kamen von dort, um Schnitzel zu bekommen. Wie tat uns das Herz weh, denn wir konnten nicht sehr viel verteilen, denn die Kinder von Linkau und wir alle hungerten auch.
Unser Verdienst bestand aus 200 Gramm Roggenkörnern. Zunächst konnten die Männer diese mit einer Schrotmühle mahlen. Als diese den Dienst versagte, mahlte sie meine Mutter auf der Kaffeemühle. Zusätzlich zum Brotbacken wurden Futterüben als Streckmittel dazugenommen. Die Suppen daraus waren auch unsere Hauptmahlzeit. Linkau war unsere letzte Station. Mit der Ernährung wurde es immer schwieriger. Es gab als Arbeitslohn nur noch ausgepreßte Sonnenblumenkuchen. Lindenblütenknospen wurden mitgekocht. Birken wurden angebohrt und daraus Sirup gekocht. Die gesteckten Saatkartoffeln wurden nachts aus der Erde geholt.
„Not bricht Eisen“. Wie sehr ersehnten wir die Ausreise nach Deutschland! Ich bangte, daß mit dem letzten Streichholz unser Leben ausgelöscht werde. Herr Marter fragte jeden Russen nach einem Streichholz. Wer als erster Feuer gemacht hatte, trug etwas Glut zum nächsten Haus. Typhus raffte Frauen und Kinder dahin. In Palmnicken gab es noch ein Krankenhaus, aber keine Medikamente. Übrigens ging ich noch ins Kallener Gutshaus hinein, hatte ich doch dort mit meiner Mutter acht Jahre meiner Kindheit glücklich verlebt. Um so mehr weh tat mir der Anblick der Verwüstungen. Ich verweilte nicht lange, um nicht zuviel davon in mich aufzunehmen. In der Wohnung meines Onkels Rudolf Goerke waren Pferde untergebracht gewesen, die Spuren zeugten davon.
Im Mai 1947 machte ich mich auf den Weg nach Seerappen. Dort wohnte der Major der Einheit, für die wir in Linkau arbeiteten. Ich bat ihn um die Ausreise nach Deutschland. Er versprach es, aber es dauerte noch bis November 1947. Es war am Morgen des Totensontags, als die Nachricht kam, daß wir mittags um 13 Uhr auf LKW verladen und zum Caspershöfer Bahnhof gebracht würden. Schnell wurden die wenigen Habseligkeiten zusammengepackt. In Caspershöfen saßen wir bis 23.30 Uhr. Endlich kam ein Güterzug, der uns nach Königsberg brachte. Dort mußten wir 3 Tage auf die Weiterfahrt warten. Als sich der Zug endlich in Bewegung setzte, stimmten wir das Loblied „Nun danket alle Gott“an.
Es war uns aber auch während der Internierungszeit immer wieder gelungen, im kleinen Kreis, von Herrn Marter geleitet, Gebetsstunden zu halten, denn der Stärkung des Wort Gottes bedurften wir.
Käthe Swiderski, geb. Goerke